Ernst Theodor Wilhelm (E.T.A.) Hoffmann. Der Sandmann
Einleitung
Wer war E.T.A. Hoffmann,
der sich nach seinem Lieblingskomponisten, Mozart, Amadeus nannte und in Berlin meist in braunen Frack zu sehen war, mit knallgelben Hosen, dazu mit geblümter Weste7
Er wurde am 24. Januar 1776 in Königsberg geboren und begann 1792 ein Jurastudium an der Universität Königsberg. Zur gleichen Zeit lehrte dort auch Immanuel Kant, bei dem er allerdings keine Lehrveranstaltungen besuchte.
Hoffmann liebte die Musik. In finanziell schwierigen Zeiten unterrichtete er in den reichen Adels- und Bürgerfamilien Musik. In seiner 1816 uraufgeführten romantischen Oper Undine schilderte er die unglückliche Liebe einer Nixe zu einem Menschen.
Nach verschiedenen Ortswechseln wird er preußischer Beamter am Kammergericht in Berlin. Vormittags arbeitete er am Gericht, anschließend widmet er sich seiner literarischen Arbeit.
1817 erschien die Kurzgeschichte Der Sandmann, im zweiten Band der Nachtstücke. In seinen Kurzgeschichten mischt er das Alltagsgeschehen mit fantastischen Vorgängen. Mit Fantasie überschreiten die romantischen Schriftsteller, wie Hoffmann, zumindest geistig die engen Grenzen des bürgerlichen Alltags. Hoffmann beschreibt die psychischen Zustände von Menschen, deren Ängste und Verunsicherungen. Alltägliches erscheint plötzlich bedrohlich und treibt den Menschen in den Wahnsinn. Er zeigt das Verborgene unter der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft und wird zum bekanntesten Vertreter der Schwarzen Romantik.
Wenn Hoffmann auch politisch als konservativ galt, hielt er sich an die Prinzipien des Rechtsstaates. Er kritisierte in seinen Kurzgeschichten mit Ironie die Willkür der feudalistischen Gesellschaft. Mit der Folge, dass sein Stück, Meister Floh, nur zensiert erschien und gegen ihn ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde, dem Hoffmann entging, weil er 1822 starb.
Inhalt
Die Kurzgeschichte beginnt als Briefroman. Die Hauptfigur Nathanael schreibt seit längerer Zeit wieder einen Brief an seine Verlobte Clara und Lothar. Er war nicht in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen.
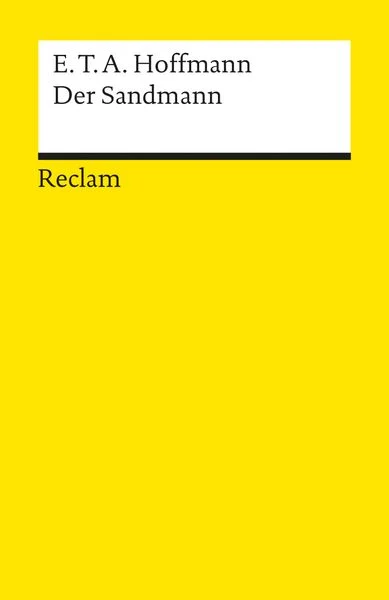
In der zerrissenen Stimmung des Geistes, der mir bisher alle Gedanken zerstörte! – Etwas Entsetzliches ist in mein Leben getreten!1
Ursache ist die Begegnung mit dem Wetterglashändler (Wetterglas: ein Barometer) Coppola, der ihn an ein traumatisches Erlebnis aus seiner Kindheit erinnert, das ihn sein gesamtes Leben verfolgen wird. Wurden die Kinder müde, sagte die Mutter,
>>Nun Kinder! – zu Bette! zu Bette! der Sandmann kommt, ich merk‘ es schon.<< 4
und gleichzeitig hörte Nathanael Geräusche im Treppenhaus.
Eine alte Frau erzählt ihm eine Horrorgeschichte über den Sandmann, die ihm Angst macht.
Das ist ein böser Mann, der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bette gehen wollen und wirft ihnen Handvoll Sand in die Augen, daß sie blutig zum Kopf herausbringen, die wirft er dann in den Sack und trägt sie in den Halbmond zur Atzung für seine Kinderchen; die sitzen dort im Nest und haben krumme Schnabel, wie die Eulen, damit picken sie der unfertige Menschenkindlein Augen auf.<<2
Seine Neugier überwindet seine Angst, um den geheimnisvollen Sandmann zu sehen. Es ist der Advokat Coppelius, der manchmal bei ihnen zu Mittag aß. Eine hässliche und abscheuliche Person mit knotigen haarigen Fäusten, der bei Nathanael Ekel und Abscheu verursacht. Ein Kinderschreck.
Sein Vater und der Advokat Coppelius führen alchimistische Experimente durch. Als Nathanael sie eines Abends bei ihren Experimenten beobachtet und in seinem Versteck entdeckt wird, geht Nathanael die Fantasie durch. Er fürchtet Coppelius will ihm, wie der Sandmann, die Augen herausreißen. Bei einem der alchimistischen Experimente kommt sein Vater ums Leben und Nathanael hält Coppelius für den Mörder seines Vaters.
Nathanael hält den Wetterglashändler Coppola und den Advokat Coppelius für ein und dieselbe Person, der auch ihn ermorden will und identifiziert beide Personen mit dem schrecklichen Sandmann. Seine Ängste verfolgen ihn in seinen Alpträumen. Er fühlt sich von dunklen Mächten und bösen Geistern beherrscht und bedroht. Ansichten, die das mittelalterliche Denken beherrschten. Die alchemistischen Experimente verbinden das Mittelalter mit dem neuen Zeitalter der Aufklärung und Wissenschaft. Die psychologischen Erklärungen von Clara stehen dem Denken der Aufklärung näher. Sie reagiert auf seine Ängste sachlich. Seine Ängste vor Coppelius und Coppola bezeichnet sie als Einbildung. Seine Ängste sind nicht real, sondern nur in seinem Inneren vorhanden.
Nathanael fällt in eine depressive Stimmung und dies belastet das Liebesglück zwischen Nathanael und Clara. Beim Vortragen eines Gedichts über seinen psychischen Zustand reagiert Clara nüchtern und Nathanael wirft Clara Gefühlskälte vor.
>>Du lebloses, verdammter Automat!<<3
Dann wechselt die Erzählperspektive und ein allwissender Erzähler schildert das weitere Schicksal von Nathanael.
Als Coppola Nathanael erneut besucht und verschiedene Brillen auf den Tisch legt, gerät er in Panik, weil er sich an die schreckliche Geschichte über den Sandmann erinnert und in den Brillen nur Augen sieht.
Er kauft von Coppola ein Teleskop, mit dem er Olimpia beobachtet, die Tochter des Professors Spalanzani, in die er sich sofort verliebt. Seinen Freunden erscheint Olimpia starr und leblos. Nathanael liest ihr stundenlang seine Gedichte vor. Obwohl sie immer nur >>Ach – Ach – Ach!<< entgegnet, ist für Nathanael ihr Schweigen ein Ausdruck ihrer Liebe zu ihm. Da sie ihm nicht widerspricht und scheinbar bewundert, bestätigt dies seinen Narzissmus.
Als er sieht, dass Olimpia eine leblose Puppe ist, der Coppola, künstliche Augen einsetzte und von einem Uhrwerk betrieben wird, an der Professor Spalanzani 20 Jahre arbeitete, führt dies bei Nathanael zu einem Wahnsinnsanfall.
Nach seiner Rückkehr zu Clara und Lothar scheint Nathanael geheilt zu sein. Auf dem Rathausturm sieht er durch sein Teleskop Coppelius und ihn befällt ein neuer Wahnsinnsanfall. Im Wahnsinn stürzt er sich vom Turm in den Tod.
Zusammenfassung
Sehen und Augen sind ein zentrales Motiv in dieser Kurzgeschichte, denn Nathanael befürchtet seine Augen zu verlieren. Coppo in dem Namen Coppola bedeutet Auge6.
Sigmund Freud hat die Kurzgeschichte psychoanalytische interpretiert und kommt – Überraschung!- zu einer sexuellen Interpretation. Für Freud steht die Angst vor dem Verlust der Augen, für die Kastrationsangst.8
Ein weiteres Motiv ist der künstliche Mensch. Bereits 1738 stellte Jacques de Vaucanson einen von Uhrwerk und Blasebälgen betriebenen Flötenspieler vor. Für die einen war Technik noch mit Magie behaftet. Andere fühlten sich in ihrem mechanistischen Weltbild bestärkt, der Mensch sei auch nur eine Maschine. Zunächst übten diese Automatenmenschen eine große Faszination aus. Allmählich wurden die (Menschen)-Maschinen den Menschen immer unheimlicher. Als Nathanael mit Olimpia tanzt, gibt sie den Takt vor, und er muss sich anpassen.
– Er glaubte, sonst recht taktmässig getanzt zu haben, aber an der ganzen eignen rhythmischen Festigkeit, womit Olimpia tanzte und die ihn oft ordentlich aus der Haltung brachte, merkte er bald, wie sehr ihm der Takt gemangelt.5
Die Maschine beherrscht die Menschen. Das Fließband ist geradezu sinnbildlich für diese vollständige Beherrschung. Es zerteilt die Arbeit in monotone Handgriffe, verhindert soziale Kontakte und macht den Menschen zu einem Sklaven der Maschine. Sehr schön zu sehen, in dem Film Modern Time von Charlie Chaplin.
Das Gespräch zwischen Nathanael und der Mensch-Maschine Olimpia verläuft ziemlich einseitig. Alexa von Amazon antwortet auf Fragen ziemlich vernünftig. Mit der KI sind umfassende Gespräche zwischen Menschen und Maschinen möglich.
Nathanael sieht nicht das Olimpia eine Maschine ist, und entwickelt für sie sogar Gefühle. Wie ist das möglich? Erinnert sei an das Tamagotchi ein virtuelles Tier, um das man sich kümmern musste, weil man es als echtes Haustier ansah!
E.T.A Hoffmann. Nachtstücke. Herausgegeben von dem Verfasser in Callots Manier. Könnemann Verlagsgesellschaft. 1994.
1) S. 7
2) S. 9
3) S. 29
4) S. 8ff.
5) S. 36
6) Lienhard Wawrzyn. Der Automatenmensch. E.T.A. Hoffmanns Erzählung vom Sandmann. Mit Bildern aus Alltag und Wahnsinn. Verlag Klaus Wagenbach. Berlin. Neuausgabe 1994. S. 96
7) ebenda S. 10
8) Sigmund Freud. Das Unheimliche. Herausgegeben von Oliver Jahraus. Reclams Universal-Bibliothek Nr. 14030. 2020, 2021 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH. S. 22 ff.




